Quartierleben
«Man darf das Staunen nicht verlernen»
Röbi Koller hat schon an vielen Orten in der Schweiz gelebt. Wieso er dennoch kein Nomade ist und was Glück für den Moderator der Sendung «Happy Day» bedeutet, erzählt er dem «Wipkinger» im Gespräch.
14. Dezember 2016 — Patricia Senn
1957 als ältester Sohn eines Elektrotechnikers und einer kaufmännischen Angestellten geboren, ging Röbi Koller in fünf verschiedenen Schweizer Städten zur Schule, bevor er schliesslich zum Studium nach Zürich kam.
Wipkinger: Sie sind als Kind oft umgezogen, wieso?
Röbi Koller: Das stimmt. Geboren wurde ich in Luzern. Dann wollten meine Eltern in die Westschweiz, also sind wir erst nach Lausanne, dann Genf und schliesslich Neuenburg gezogen. Irgendwann hatte mein Vater eine Stelle in Zürich und wir zogen zuerst nach Cham, dann nach Zug, wo ich auch das Gymnasium absolvierte. Als Kind konnte ich ja nicht mitentscheiden. Aber darunter gelitten habe ich nicht. Ich glaube, wenn die «homebase» stimmt ─ das Zuhause bei den Eltern ─ fällt einem das Zügeln nicht so schwer. Schwieriger wird es, wenn dort auch der Halt fehlt. Es hatte ja auch Vorteile: Ich bin zweisprachig aufgewachsen und habe gelernt, mich schnell an neue Situationen anzupassen.
Wird man da nicht ein wenig rastlos?
Das bin ich lustigerweise gar nicht, nein. Als Erwachsener wurde der Radius, in welchem ich mich bewege, kleiner. Ich habe in Zug gewohnt, dann in Baden und jetzt mit meiner zweiten Frau in Zürich. In dieser Wohnung leben wir jetzt schon 14 Jahre. Mir gefällt es hier, ich denke, ich bin angekommen. Aber ich reise sehr gerne ─ vielleicht ist das eine Folge des früheren «Nomadentums».
Was gefällt Ihnen an Wipkingen?
Wir haben ein freundschaftliches Verhältnis zu den Nachbarn im Haus. Im Sommer treffen wir uns oft im Garten und unternehmen manchmal sogar eine Reise zusammen. Im Quartier bin ich verwurzelt: Ich kaufe hier ein, mein «Velomech» ist gleich um die Ecke und man trifft mich auch schon mal im Nordbrüggli oder in der Osteria auf ein Glas. Lange habe ich Beizen und Läden vermisst, jetzt bin ich froh, dass Wipkingen nicht mehr nur ein Schlafquartier ist. Der Röschibachplatz ist ein schönes Zentrum geworden, da passiert in den nächsten Jahren bestimmt noch mehr. Und dennoch behält das Quartier seinen dörflichen Charakter: Hier bin ich nicht der Promi, sondern einfach Röbi oder Herr Koller. Man kennt und grüsst sich, ist einfach hier zuhause. Das schätze ich sehr. Auch die Durchmischung stimmt: Es gibt Junge, Alte, Ausländer, Schweizer, ein farbiges Quartier. Es hat sogar einen Vorteil, dass wir am Hang wohnen: Mit dem Velo von der Stadt hochzufahren, ist für mich immer ein regelrechtes Workout.
Röbi Koller, der mit 24 Jahren über eine Anstellung bei Radio 24 zum Journalismus fand und seither unzählige Radio und Fernsehsendungen moderiert hat, ist ein Tausendsassa: Bei SRF2 Kultur moderiert er im Vierer-Team die Sendung «Musik für einen Gast», zu der eine prominente oder nicht-prominente Persönlichkeit eingeladen wird, um über ihre Lieblingslieder und deren Bedeutung zu sprechen. Sein erster Gast war der Schriftsteller Leon de Winter, das Gespräch mit ihm wurde am 30. Oktober ausgestrahlt. Im monatlichen Literaturtalk «Züri Littéraire» lädt er mit Mona Vetsch Schriftsteller ins Kaufleuten ein, um über ihre Bücher zu reden, selber hat er schon zwei Biografien und ein Kochbuch geschrieben und arbeitet an einem weiteren Buch. Nicht zuletzt engagiert er sich als Botschafter für das Hilfswerk Comundo. Und dann ist da noch die Samstagabendshow «Happy Day».
In dieser Sendung wird ja ziemlich viel geweint. Wie gehen Sie damit um?
Es ist ja nicht so, dass in dieser Sendung geweint werden muss. Es ist ja eine Schweizer Eigenart, dass man die Emotionen nicht so nach aussen trägt ─ in Amerika wird da viel extremer gejubelt und geheult. Bei uns jubelt man etwas stiller und trauert auch stiller. Ich glaube, deshalb erkennen sich viele Leute in dieser Sendung wieder. Abgesehen davon, dass auch oft gelacht wird. Wenn man die Menschen dazu bringt, ihre schweren Geschichten zu erzählen, muss man sie danach auch wieder aus dem Tal herausführen. Man darf sie nicht einfach alleine lassen. Deshalb ist lachen genauso wichtig wie trauern. Aber es bewegt mich natürlich auch, und obwohl ich mich abgrenzen muss ─ schliesslich ist es mein Beruf ─ kommen mir manchmal selber die Tränen.
Die Sendung lebt von diesen Momenten, ohne sie würde das Format nicht funktionieren. Sehen Sie da eine Schwierigkeit?
Medienleute haben da mehr Berührungsängste, sie halten es schnell für nicht echt. Menschen, die nichts mit den Medien zu tun haben, denken anders. Sie freuen sich, einmal im Mittelpunkt stehen zu dürfen. Es gibt Leute, die von «Happy Day» überrascht wurden und noch Jahre später davon schwärmen, was für eine schöne Erfahrung das war. Die Fernsehsendung ist ja nur ein Teil des Ganzen, die Überraschung an sich ist das, was es ausmacht. Es sind ganz gewöhnliche Menschen, manche hatten vielleicht nicht so viele Chancen im Leben und freuen sich, wenn einmal jemand etwas für sie macht. Wenn wir nach zwei Jahren ein «Danke Happy Day» machen, also eine Rückschau, bei der wir zeigen was aus ihnen wurde, dann erinnern sie sich noch an alles ganz genau. Das ist doch toll!
Sie haben zwei Bücher über zwei aussergewöhnliche Persönlichkeiten geschrieben: Extrembergsteiger Stephan Siegrist und Nils Jent, der sich trotz schwerer Behinderung zum Professor für Diversität in St. Gallen hochgearbeitet hat. Was haben Sie aus diesen Begegnungen mitgenommen?
Dass enorme Leistungen auch grosse Opfer erfordern. Bei den Bergsteigern sind diese offensichtlich: Kälte, Wind, physische Anstrengungen. Man geht bis an seine Grenzen und muss selber entscheiden, wo man aufhören muss. Das Buch über Siegrist fängt damit an, dass er mit dem jüngeren Kollegen Ueli Steck unterwegs ist und an einen Hang kommt, der nach objektiven Kriterien stark lawinengefährdet ist und an dem es am Vortag schon kleinere Abrisse gab. Siegrist entschied sich damals für den sicheren Weg und kehrte um. Damit opferte er den Triumph, denn sein Kollege ging weiter und schaffte es auf den Gipfel. Im Alltag sind die Entscheidungen vielleicht nicht immer so folgenschwer, aber im übertragenen Sinn kommen alle einmal in einen «Clinch». Wo steckt man die Grenze, wann lohnt es sich, sie zu überschreiten? Das weiss man immer erst im Nachhinein. Menschen kennenzulernen, die sich ständig selber herausfordern, gibt einem auch den Ansporn, selber öfter aus der Komfortzone rauszukommen. Ich bin eigentlich ein bequemer Mensch, der den einfacheren Weg geht. Doch manchmal muss man über Hindernisse hinweg steigen, um einen anderen Horizont zu bekommen. Bei Nils Jent war es sein unbändiger Wille, der mich beeindruckte. Allein, wie er sich den ganzen Stoff des Gymnasiums mit Hilfe von Tonbandkassetten beibrachte, die seine Mutter besprochen hatte.
Was machen Sie, wenn Sie einmal Ihre Ruhe haben wollen?
Hier in unserer Wohnung kann ich mich gut zurückziehen. Aber ich treffe mich auch gerne mit Freunden zum Kochen oder besuche Konzerte, gehe ins Kino oder ins Theater ─ Zürich bietet da ja bekanntlich ein riesiges Angebot. Velofahren oder Joggen entspannt mich auch. Manchmal setzte ich mich einfach in den Zug und fahre nach Lugano, kaufe etwas für das Abendessen ein und komme wieder zurück. Die Landschaft zieht an mir vorbei und ich habe Muse zum Schreiben. Das finde ich toll.
Was macht Sie persönlich glücklich?
Ich glaube, man muss das Glück erkennen, es ist nicht so, dass es sich einem einfach präsentiert. Glücklich sein zu können, ist eine Fähigkeit. Es gibt Menschen, die kein Talent dafür haben, das Positive zu sehen. Natürlich gibt es solche, denen es wirklich schlecht geht, aber wir alle kennen Leute, die bescheiden leben und trotzdem glücklich sind. Weil sie das schätzen, was sie haben. Seien das Freunde, materielle Dinge oder schöne Momente. Auch ich könnte hadern und sagen, ich habe es nur in der deutschen Schweiz «geschafft», das ist zu wenig. Gegen oben ist immer Luft. Doch ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich habe. Meine Frau, meine Familie, meine Freunde, all die schönen Momente, die ich erleben darf, das macht mich glücklich. So war ich eigentlich schon immer, deshalb glaube ich, dass es auch eine Veranlagung sein könnte. Etwas wie ein Grundoptimismus oder ein Grundvertrauen in die Menschen, in das Leben. Anderen Menschen gegenüber immer skeptisch, misstrauisch oder negativ eingestellt zu sein, ist mir letztlich zu anstrengend. Natürlich gibt es zurzeit auf der Welt und auch bei uns in der Schweiz gesellschaftliche Tendenzen, die in eine ganz andere Richtung gehen. Da ist es wichtig, gerade für uns Medienschaffende, eine positiven Haltung zu bewahren und die Wichtigkeit von Werten wie Anstand und Solidarität zu betonen. Zum Beispiel, indem wir Minderheiten akzeptieren und schützen, wie es in der Schweiz Tradition hat. Das kostet uns etwas, finanziell und emotional, denn es ist anstrengend, auf andere zuzugehen und miteinander auskommen zu wollen, obwohl man nicht dieselbe Sprache, Religion oder dasselbe soziale Umfeld hat. Und es ist jeden Tag von Neuem anstrengend. Weil man es vorleben muss. Reden alleine reicht nicht aus.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Nächstes Jahr werde ich 60, in meinem Umfeld sprechen alle von der Pensionierung. Damit muss ich mich auch irgendwann auseinandersetzen. Bis es soweit ist, möchte ich noch gute Arbeit machen können. Ich könnte mir durchaus vorstellen, meine eigene Biografie zu schreiben. Wahrscheinlich werde ich einfach langsam reduzieren und ganz sanft aussteigen. Soziologen sagen schon lange, dass ein abrupter Schnitt mit 65 nicht gut ist. Man sollte ab 50, wenn die Leistungskurve am höchsten ist, langsam wieder abbauen. Aber die Wirtschaft ist da noch nicht so weit. Es wäre aber auch schön, wenn es weiterhin neue Projekte gäbe – schliesslich hat man, wenn es gut geht, noch 20 Jahre vor sich. Ich möchte wach bleiben und das Staunen nicht verlernen.
Herzlichen Dank für das spannende Gespräch.
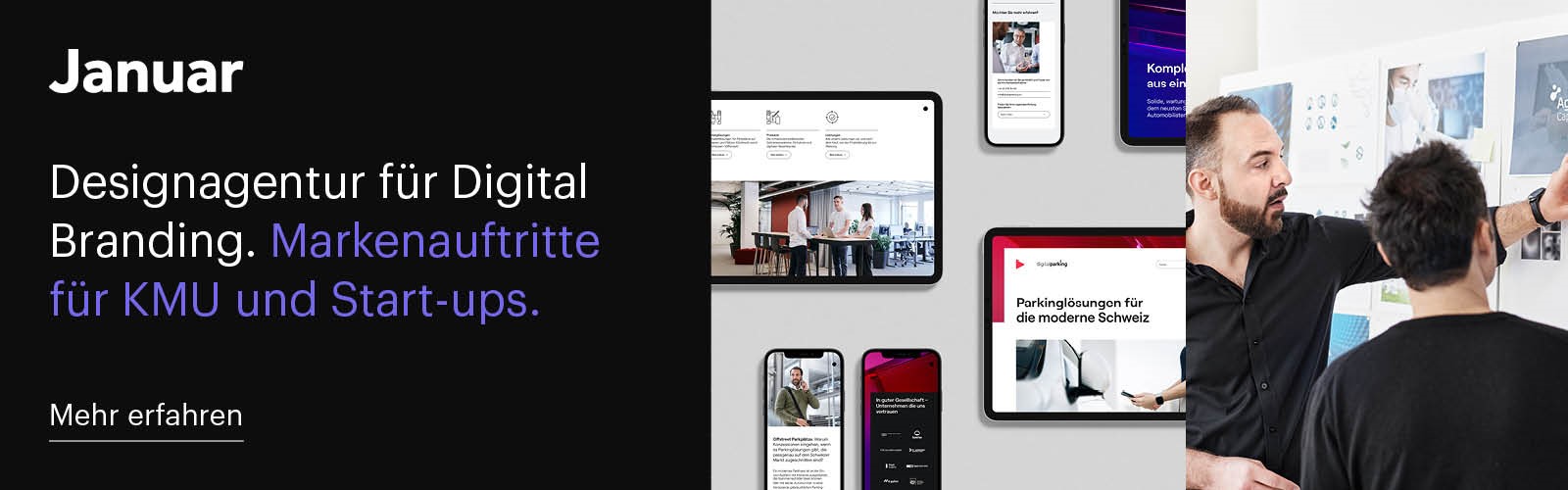
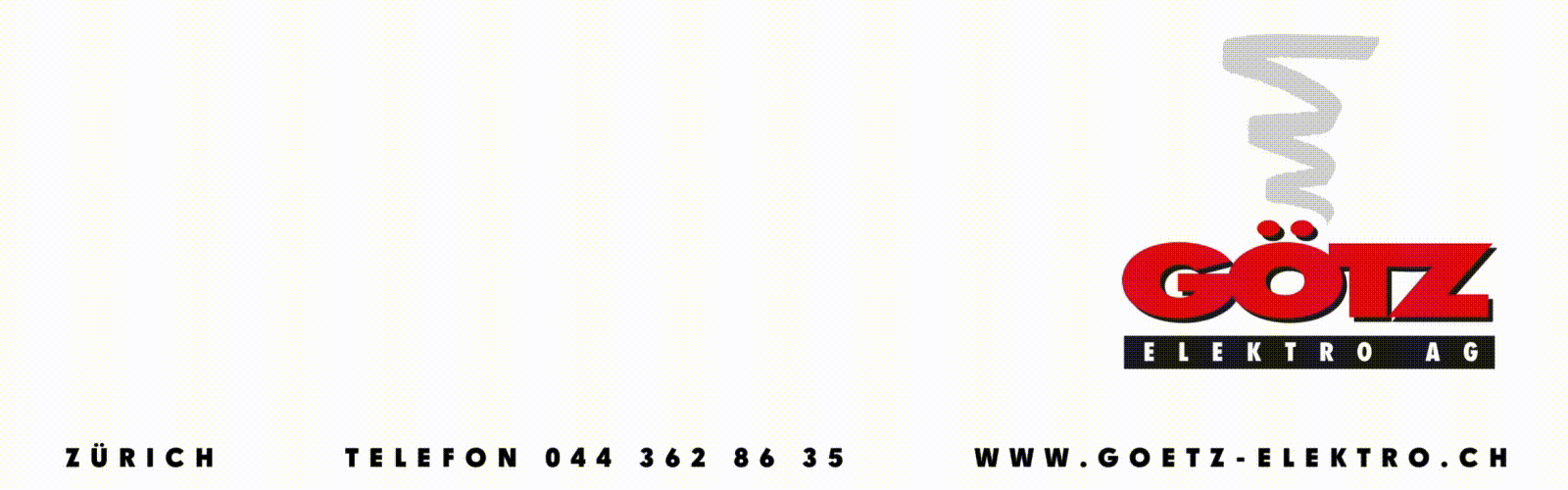
0 Kommentare